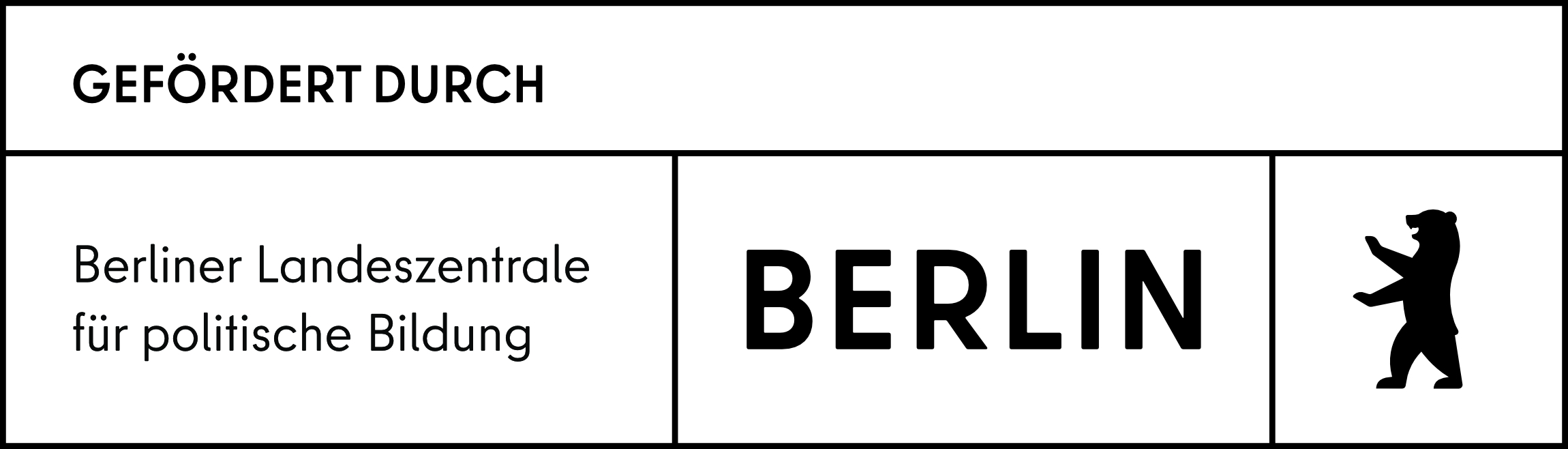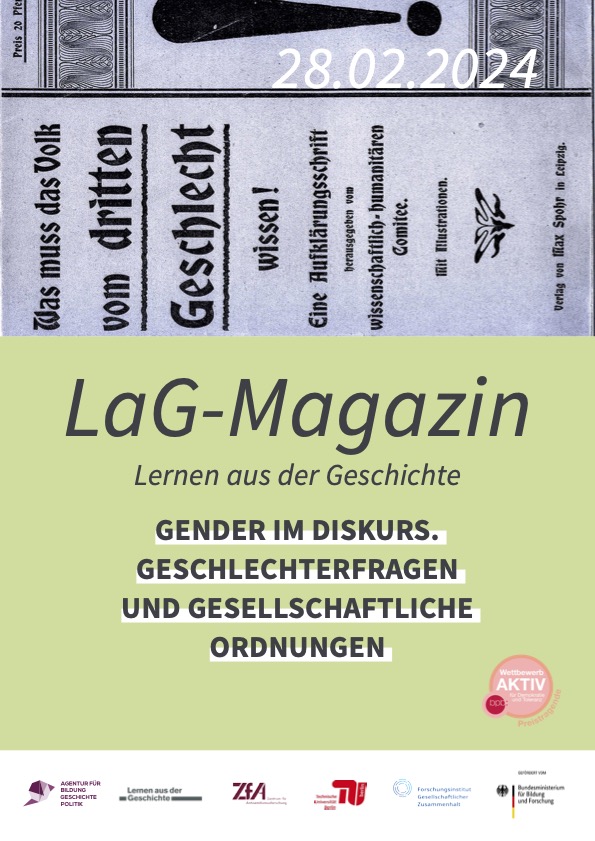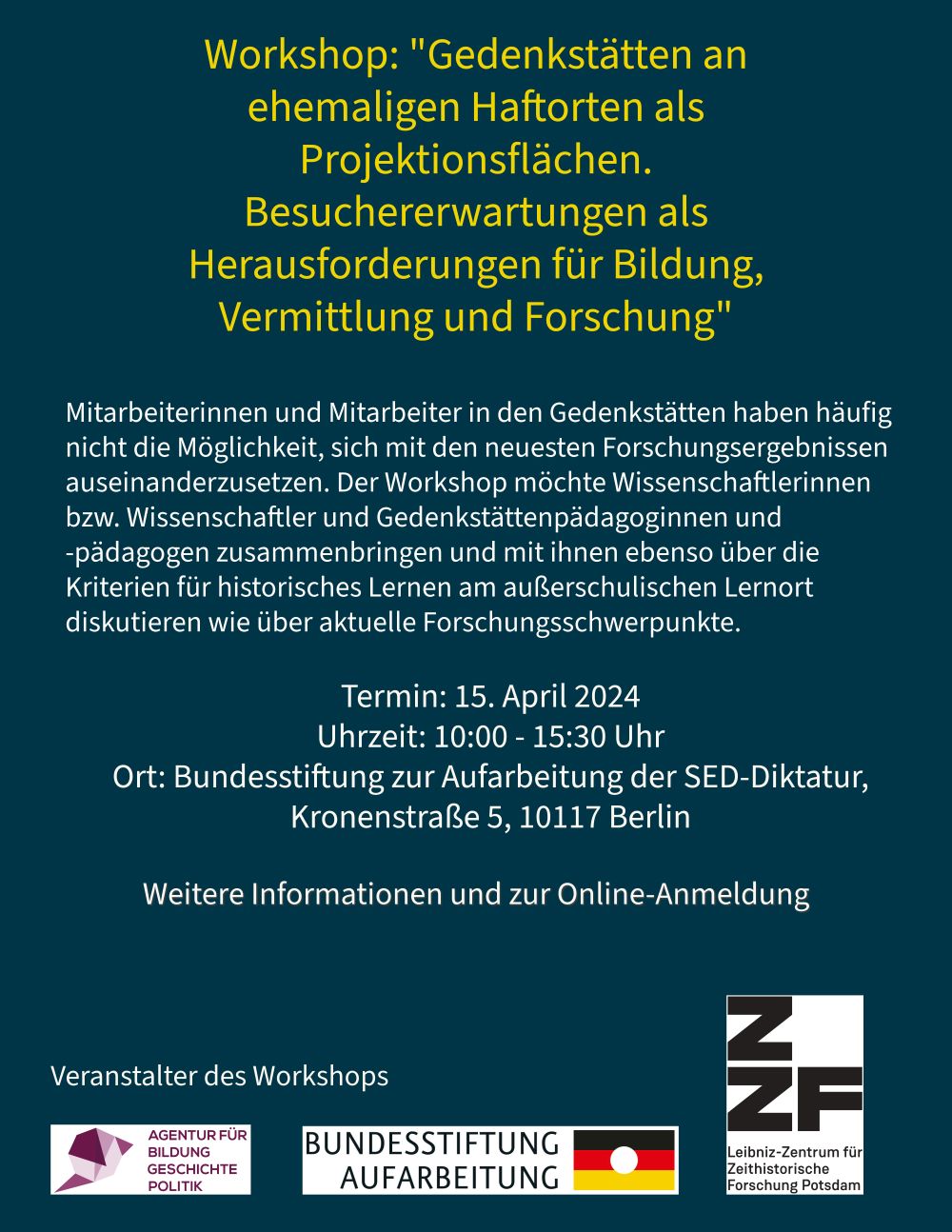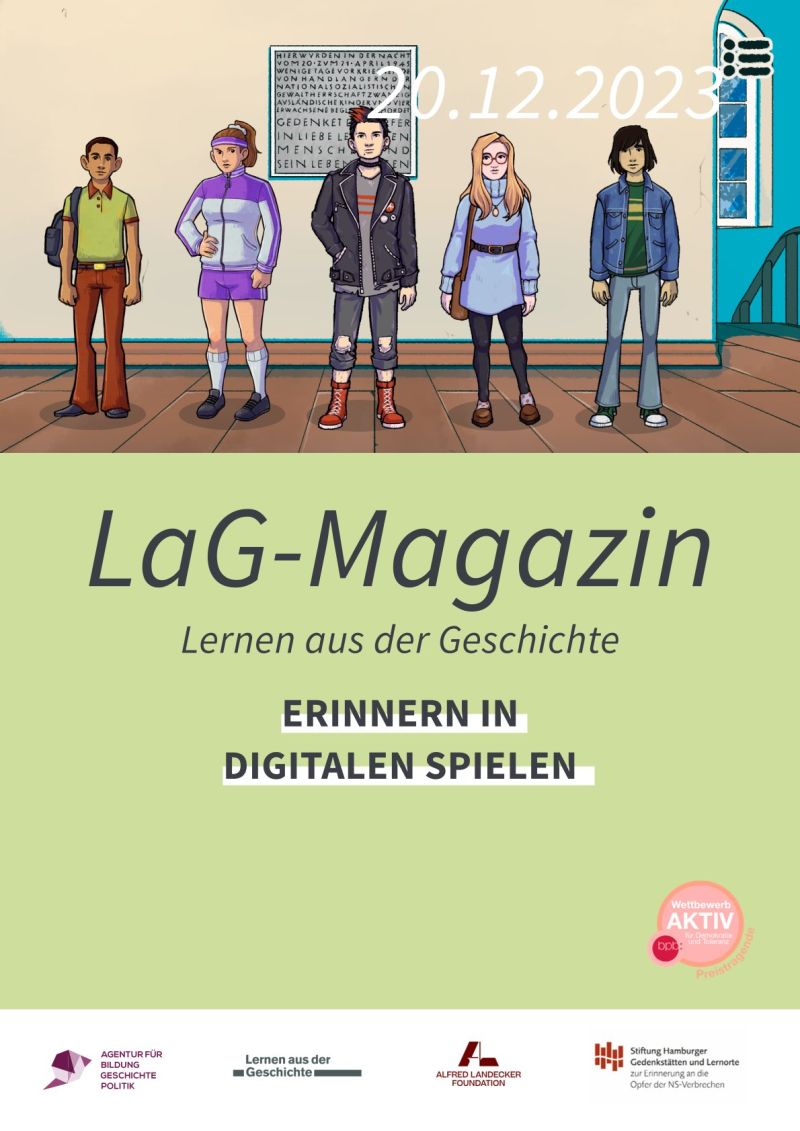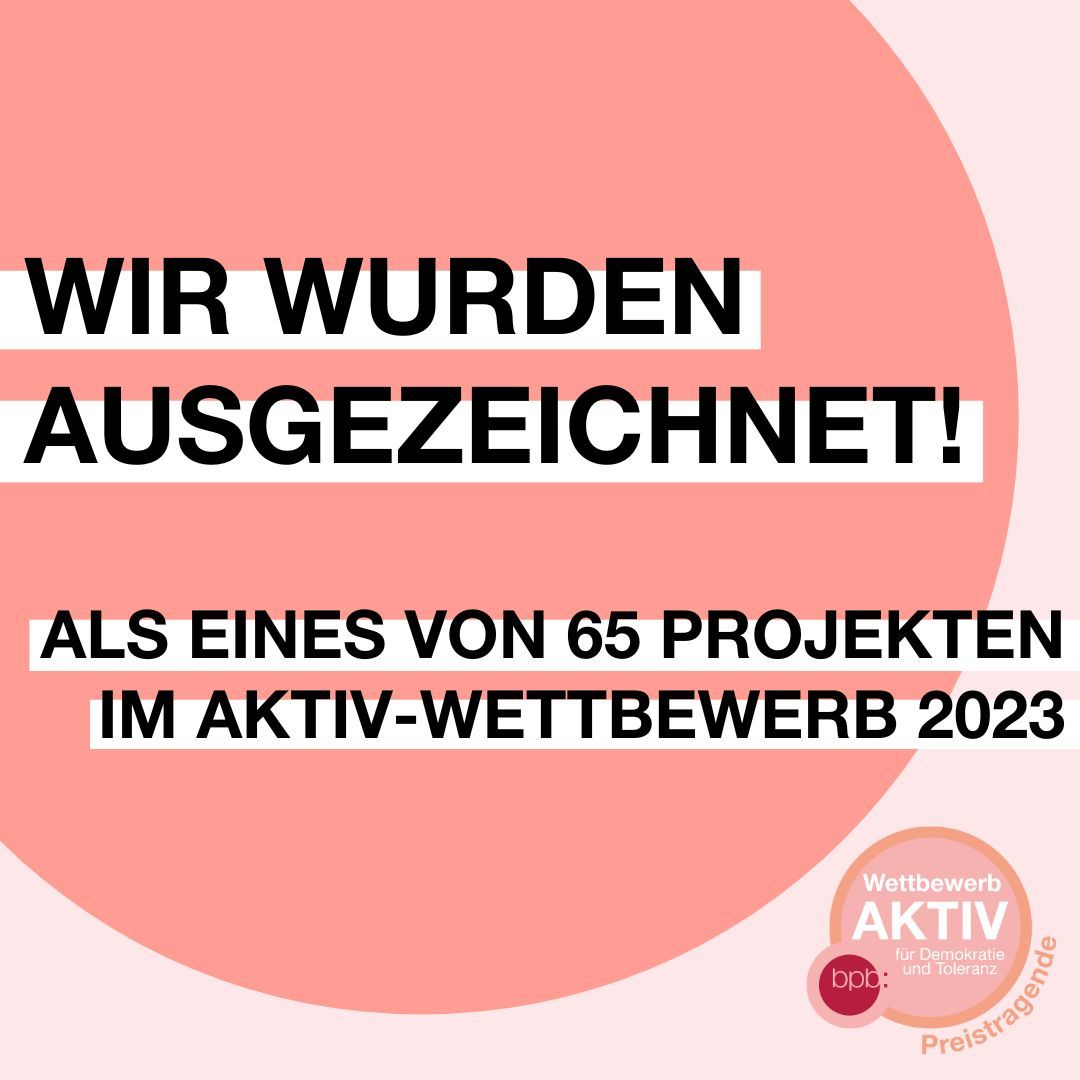Die Ausstellung "Gemeinsam sind wir unerträglich" ab 18.9. in Stralsund
Startseite
Kommende Ausstellungsstation in Stralsund!
Die Ausstellung wird am 18.09.2024 im Einkaufszentrum STELAPARK eröffnet (Grünhufer Bogen 13-17) und ist dort bis 27.9.2024 zu sehen.
Vernissage: 18.09.2024, 17:30 Uhr mit Ulrike Rothe, Kuratorin, und Heike Schimkat, Historikerin für die Stralsunder Frauenbewegung sowie der Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Jacqueline Bernhardt.
Die Ausstellungsstation erfolgt in Kooperation mit der Stadt Stralsund und der Gleichstellungsbeauftragten Olga Fot.
Kommende Stationen:
Gedenkstätte Andreasstraße Erfurt (ab 7. November 2024)
Rostock im März 2025
Dresden (vor.) April 2025
Universität Oldenburg im Mai/Juni 2025
Autonomes Frauenzentrum Potsdam Aug – Okt. 2025
HU Berlin/Theologische Fakultät im November 2025
Nähere Informationen finden Sie jeweils in zeitlicher Nähe zu den einzelnen Stationen hier auf dieser Website.
Pressestimmen
Beitrag auf Deutschlandfunk Kultur über unsere Ausstellung: „Gemeinsam sind wir unerträglich“: Die DDR-Frauenbewegung (gesendet 24.01.2024)
Beitrag auf Radio 1 zur Vernissage 11.01.2024 in der Stasi-Zentrale. Campus für Demokratie
Die Wanderausstellung "Gemeinsam sind wir unerträglich"
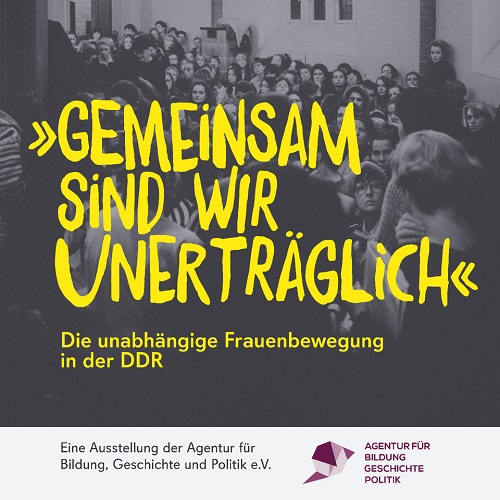
Startseite
Die Wanderausstellung "Gemeinsam sind wir unerträglich"
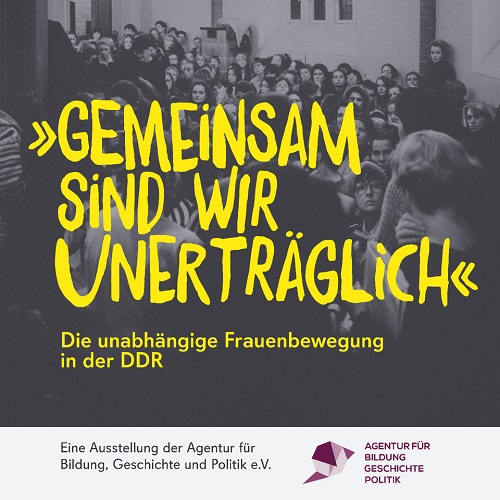
LaG-Magazin "Erinnerung an den Widerstand gegen den Staatssozialismus in Ostmitteleuropa"
Startseite
In den Ländern Ostmitteleuropas verändert sich die Erinnerungspraxis an den Widerstand gegen den Staatssozialismus und die kommunistischen Diktaturen derzeit stark. Das nimmt das aktuelle LaG-Magazin zum Anlass, vergleichend auf die Erinnerungskulturen in dieser Region zu schauen. Gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Wir bedanken uns herzlich für die Förderung!
Einführung in das LaG-Magazin 8/2024
In den Ländern Ostmitteleuropas verändert sich die Erinnerungspraxis an den Widerstand gegen den Staatssozialismus und die kommunistischen Diktaturen derzeit stark. Erinnerungskulturen sind generationell und gesellschaftlich bedingt immer fluide, aber mit zunehmendem Abstand zu den Umwälzungen von 1989/90 bricht sich in einigen ostmitteleuropäischen Ländern eine Verklärung der sozialistischen Ära Bahn. Zugleich rücken nationale Narrative, die zur Legitimierung der aktuellen Politik dienen, in den Vordergrund.
Die Demokratisierungsprozesse der 1990er- und 2000er- Jahre setzen sich nicht bruchlos fort, sondern werden mancherorts durch teils autokratische Strukturen ersetzt. Zivilgesellschaftliche wie erinnerungskulturelle Akteure werden in ihren Meinungsäußerungen und anderem politischen Handeln eingeschränkt, ihr Engagement teils verboten.
Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verändert, wie heute in Ländern Ostmitteleuropas an den Widerstand gegen den Staatssozialismus erinnert wird. Diese starken Dynamiken innerhalb der Erinnerungskultur geben ebenso wie geschichtspolitische Interventionen Anlass, aus verschiedenen Perspektiven differenziert auf diese Region und vergleichend auf ihre Erinnerungskulturen zu schauen.
Florian Peters spannt im Gespräch mit dem LaG-Magazin ein breites wie facettenreiches Panorama auf. Er beleuchtet einige Besonderheiten der Region und führt die Leser*innen durch die zeitlichen Phasen des Widerstandes gegen den Staatssozialismus.
Peter Oliver Loew erörtert die für Europa beispiellose Intensität und Kontinuität des polnischen Widerstandshandelns im 20. Jahrhundert. Dabei zeigt er, inwiefern Polen in mancherlei Hinsicht eine besondere Rolle in Ostmitteleuropa spielt(e).
Peter Jašek zeichnet am Beispiel der Tschechoslowakei nach, welch erbitterte Kontroversen noch heute um das Erinnern an den Widerstand gegen den Staatssozialismus geführt werden. Der Text erscheint auf Englisch und auf Deutsch.
Árpád von Klimó vergegenwärtigt, dass mit Victor Orbán, der sich prorussisch äußert und sich gegen die Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hat, heute jemand an der Spitze eines autoritären Regimes steht, der sich einst im antisowjetischen Widerstand gegen den Staatssozialismus engagierte.
David Feest zeigt auf, wie im sogenannten „Phosphoritkrieg“ die Umweltbewegung in Estland als Katalysator einer nationalen Mobilisierung gegen die sowjetische Herrschaft gewirkt hat.
Nationale Geschichte wird oft in Denkmälern symbolisiert. Stephanie Beetz gibt einen Einblick, wie sowjetische Denkmäler in Ostmitteleuropa abgebaut wurden, was mit ihnen passierte und wie Denkmäler als Gegenstand der historisch-politischen Bildung betrachtet werden können.
Sabrina Pfefferle stellt Frauen aus der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność vor und geht der Frage nach, warum deren Rolle bis heute unterbelichtet ist. Sie beschreibt, warum sich Filme, in deren Zentrum der Widerstand von engagierten Frauen steht, sich für eine erinnerungspolitische Annäherung an das Thema eignen.
Wir bedanken uns herzlich bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die Förderung dieser Ausgabe.
Spielfeld Deutschland - Workshop für die Grundschulen
Startseite
Unser Angebot für den Gewi- und Sachunterricht an Berliner Schulen.
- Zielgruppe: Schüler*innen der Klassen 4 bis 6
- Dauer: 90 Minuten
- Kosten: keine
Lernen im Spiel
Der Workshop „Spielfeld Deutschland“ vermittelt Schüler*innen der Klassen 4 bis 6 einen spannenden und anschaulichen Einblick in die Blockkonfrontation des Kalten Krieges, die Teilung Berlins sowie die Lebensverhältnisse in Ost und West.
In drei Spielrunden erfahren die Schüler*innen durch praktische Übungen und Aufgaben, wie sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei politische Systeme spaltete. Sie lernen, welche Rolle die Alliierten bei der Teilung Berlins spielten und wie sich die Lebensbedingungen in Ost und West unterschieden.

Konkrete Vorteile für Schüler*innen
- Die Schüler*innen erhalten einen vertieften Einblick in ein wichtiges historisches Thema.
- Sie lernen, sich eigenständig und kreativ mit historischen Themen auseinanderzusetzen.
- Sie entwickeln ein Verständnis für die Ursachen und Folgen des Kalten Krieges.
Anmeldung
Der kostenfreie Workshop kann jederzeit über den Lernort Keibelstraße gebucht werden.
Mail: anmeldung@keibelstrasse.de
Telefon: 030 – 28 09 80 11
Ausstellung "Punk in der Kirche. Ost-Berlin 1979-89" in der Ausstellung BERLIN GLOBAL am Humboldt Forum Berlin
Startseite
Am kostenfreien Museumssonntag, dem 7. Juli 2024, wurde in der Ausstellung BERLIN GLOBAL die neue Schau „Punk in der Kirche. Ost-Berlin 1979-89“ mit einem Konzert der Punk-Band Planlos eröffnet.
Pressestimmen:
https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20240707_1930/news.html
https://www.kindaling.de/ausstellungen/punk-in-der-kirche-ost-berlin-1979-89/berlin-mitte
https://taz.de/Subkultur-in-der-DDR/!6020690/
Der als dauerhafte Ergänzung konzipierte Ausstellungsbereich wurde von der Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V. für BERLIN GLOBAL kuratiert. Die Agentur hat bereits mehrere Projekte zur Aufarbeitung von Punk in der DDR initiiert. Sie bringt marginalisierte Perspektiven in die vorherrschenden Geschichtsbilder ein und greift Leerstellen auf. Dabei vermittelt sie aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft in die erinnerungskulturelle Praxis.
Projektbeteiligte:
Ulrike Rothe und Birgit Marzinka, Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V., Kuratorinnen
Dr. Frauke Miera, Stiftung Stadtmuseum Berlin, Projektleitung und kuratorische Begleitung
Anne Hahn, freie Autorin und Zeitzeugin
Jan Haverkamp und Tobias Rischk, Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V.
Gestaltung: studio it‘s about (Charlotte Kaiser und Andrea Kowalski unter der Mitarbeit von Freia Antonia Weiss)
Punk in Ost-Berlin
Die kleine, urbane Bewegung Punk erregte ab Ende der 1970er Jahre in Ost-Berlin durch ihr Erscheinungsbild Aufsehen. Sie trafen sich am Alexanderplatz, im Kulturpark Plänterwald und auf der Straße. Was im Westen als Provokation galt, war in der DDR ein Angriff auf den Staat und wurde bekämpft. Die Norm, wie Jugendliche sein und leben sollten, war durch die staatliche Jugendorganisation FDJ (Freie Deutsche Jugend) vorgegeben. Die Ost-Berliner Punks suchten alternative Lebensentwürfe und stellten, wie überall auf der Welt, das kleinbürgerliche Leben provokativ in Frage. Wie in vielen subkulturellen Jugendgruppen spielte Musik eine große Rolle. Die Jugendlichen gründeten Bands und spielten in besetzten Häusern, in Kellern und auf Dachböden. Die Songtexte vieler Bands kritisierten Staat und Gesellschaft fundamental, massive staatliche Repression und ein Leben in den Sphären des Ost-Berliner Untergrunds waren die Folge.
Die Schau im Ausstellungsraum „Freiraum“ in BERLIN GLOBAL erzählt die Geschichte dieser jugendlichen Subkultur zwischen Aufbegehren, Verfolgung und Beharren.
Der Themenbereich führt die Besucher*innen in den Kirchenraum hinein, den die Punks für sich als Freiraum erringen konnten; ihre Bands spielten hier Konzerte. Einige der bekanntesten Punksongs – „Nazis wieder in Ost-Berlin“ von Namenlos oder „Wir wollen immer artig sein“ von Feeling B – werden in der Ausstellung hörbar. Ein dreiminütiger Film erzählt die Geschichte der Ost-Berliner Punkbewegung und zeigt zahlreiche historischen Fotografien. Exponate made in GDR wie Schmuckaccessoires, Musikkassetten oder eine originale Punk-Lederjacke führen Ausstellungsbesucher*innen in die Welt des Ostpunks hinein. Eine Wandkarte zeigt exemplarisch die Verortungen der Szene in der Stadt und ihre Verbindungen nach Ost- und Westeuropa. Ost-Berliner Punks waren ebenso rebellisch wie ihre Gleichgesinnten im Westen, aber ihre Existenz war stets bedroht und ihr Überleben sicherten sie in Nischen.
Datum: Sonntag, 7. Juli 2024 | 14 – 16 Uhr
Veranstaltung:
Eröffnung von „Punk in der Kirche. Ost-Berlin 1979-89“ in der Ausstellung BERLIN GLOBAL
Einführende Grußworte von Paul Spies, Direktor Stiftung Stadtmuseum Berlin,
Kuratorin Ulrike Rothe, Projektleiterin Frauke Miera
Konzert mit der Punk-Band Planlos
Führungen/Gespräche in der Schau mit Anne Hahn, Ulrike Rothe und Jan Haverkamp
Ort: BERLIN GLOBAL, Humboldt Forum, Schlossplatz 1, 10178 Berlin
Eintritt frei: Kostenfreie Zeitfenstertickets max. 7 Tage vor Veranstaltung buchbar im Ticketshop des Museumssonntags Berlin: https://www.museumssonntag.berlin
BERLIN GLOBAL
Auf 4.000 Quadratmetern thematisiert BERLIN GLOBAL in sieben Themenräumen Fragen wie: Was ging und geht von Berlin in die Welt? Was wirkte in die Stadt zurück? Und wie wollen wir sie gestalten? In atmosphärischen Inszenierungen werden die ausgewählten Aspekte Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode und Verflechtung nacherlebbar. Auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen auf YouTube, Instagram und Facebook erhalten Interessierte weitere Einblicke in die Ausstellung.
LaG-Magazin "Mehr als Faktencheck! Perspektiven auf historische Forschung von Schüler:innen"
Startseite
Das aktuelle LaG-Magazin diskutiert unterschiedliche Perspektiven auf historische Forschung von Schüler:innen im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten der Körber-Stiftung. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung.
Link zum aktuellen LaG-Magazin
Einführung in das LaG-Magazin
Welchen Beitrag können Kinder und Jugendliche für die Entwicklung lokaler Geschichtskulturen leisten? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben sie durch eigene historische oder biografische Forschungen? Und inwiefern geraten Prozesse des forschend-entdeckenden Lernens im Zeitalter ‚fragiler Fakten‘ unter Druck?
Auf dem 54. Deutschen Historikertag, der im September 2023 in Leipzig unter dem Motto „Fragile Fakten“ stattfand, organisierten Kirsten Pörschke (Körber-Stiftung) und Prof. Saskia Handro (Universität Münster) das Panel „Mehr als Faktencheck! Historische Forschung von Schüler:innen als geschichtskulturelles Kapital“. Hier wurde ausgehend vom Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, den die Körber-Stiftung ausrichtet, darüber diskutiert, welche gesellschaftliche Funktion und welche Potenziale historische Forschungen von Schüler:innen in Zeiten ‚fragiler Fakten‘ haben.
Im Anschluss an die Diskussionen des Panels entstand die Idee, den Fokus zu weiten, die Beiträge in einer LaG-Ausgabe zu dokumentieren und in eine multiperspektivische Gesamtschau einzubetten, die den Geschichtswettbewerb, die Herausforderungen der Digitalisierung für das forschend-entdeckende Lernen und die Möglichkeiten der Partizipation an historischer Forschung und Geschichtskultur im Rahmen des Wettbewerbs abbildet.
Unter welchen Gesichtspunkten dies geschieht, erläutern Kirsten Pörschke und Saskia Handro im Vorwort.
Fachwissenschaftler:innen skizzieren den theoretischen Rahmen des Wettbewerbs und diskutieren Potenziale und Grenzen von Schüler:innenforschung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und medialer Veränderungsprozesse.
Saskia Handro greift dabei das Thema des Historikertags auf und ordnet die Schüler:innenforschung ins Zeitalter der ‚fragilen Fakten‘ ein.
Dorothee Wierling blickt auf die Geschichte des Wettbewerbs und zeigt auf, inwiefern er von Beginn an in einer fruchtbaren Wechselwirkung mit der Geschichtswissenschaft als Disziplin stand.
Aus der Perspektive der Geschichtsdidaktik fragt Sebastian Barsch nach dem Beitrag, den der Wettbewerb zu einer inklusiven Geschichtskultur zu leisten vermag.
Anke John schlägt in diesem Zusammenhang vor, Impulse der Citizen Science für die Schüler:innenforschung aufzugreifen, um noch mehr Partizipation zu ermöglichen.
Christian Bunnenberg fragt aus der Perspektive der Public History nach Gegenwart und Zukunft des Geschichtswettbewerbs in einer Kultur der Digitalität.
Der Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath führt die mediale Resonanz vor Augen, die Wettbewerbsbeiträge mitunter hervorgerufen haben, und verdeutlicht damit, dass der Wettbewerb bei Schüler:innen nicht nur geschichtswissenschaftliche Kompetenzen fördert, sondern sie auch im Umgang mit Medien schult und sie dazu ermächtigt, die regionale Geschichtskultur aktiv mitzugestalten.
Im zweiten Teil kommen die Akteur:innen selbst zu Wort:
Der Geschichtswettbewerb lebt davon, dass Teilnehmende zum Teil bislang unbekannte Quellen recherchieren und auswerten. Dabei werden sie von Archivar:innen unterstützt. Diese leisten jedoch oftmals mehr als das; sie sorgen eigeninitiativ für eine lokale Sichtbarkeit der Beiträge und gestalten so Geschichtskultur vor Ort, wie Annekatrin Schaller und Philipp Erdmann zeigen.
Die Tutor:innen Janine Körner, Uta Knobloch und Matthias Meyer, die mit ihren Lerngruppen am Wettbewerb teilgenommen haben, berichten im Gespräch von ihren Erfahrungen und geben Hinweise, was eine Teilnahme für ihre Schüler:innen und für sie als Lehrkräfte bedeutet.
Ein wesentliches Gremium für einen Wettbewerb ist die Jury. Im Geschichtswettbewerb sind mehrere Landesjurys und nachfolgend eine Bundesjury für die Bewertung der Beiträge zuständig. Jury-Mitglieder haben Katharina Trittel berichtet, nach welchen Kriterien die Prämierung erfolgt, welche Aspekte ihnen die größte Freude bereiten, welche Potenziale sie in Schüler:innenforschung sehen und vor welche Herausforderungen ihre Tätigkeit sie stellt.
Wer steht bei der Körber-Stiftung hinter dem Geschichtswettbewerb? Wie wird er intern organisiert und wie gelingt es, thematisch, methodisch und in seinen Formaten am Puls der Zeit und für die Teilnehmenden interessant zu bleiben? Die LaG-Redaktion hat bei der Programm-Managerin des Geschichtswettbewerbs, Kirsten Pörschke, nachgefragt.
Nicht nur im Geschichtswettbewerb wird geforscht, es wird auch über ihn geforscht. Johanna Glandorf, Lukas Greven, Moritz Heitmann, Johannes Schmitz und Wanda Schürenberg stellen in Kurzinterviews ihre Dissertationsprojekte vor, die sich mit unterschiedlichen Facetten von Schüler:innenforschung befassen. Sie beleuchten den Wettbewerb damit nicht als Plattform, sondern als Gegenstand geschichtsdidaktischer Forschung.
Wir freuen uns, dass aus dem Austausch auf dem Historikertag eine gemeinsame LaG-Ausgabe entstanden ist, und bedanken uns sehr herzlich bei denen, die mit ihren Beiträgen diese Gesamtschau mit all ihren unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht haben. Außerdem bedanken wir uns ebenso herzlich bei der Körber-Stiftung für die Zusammenarbeit.
LaG-Magazin "Gender im Diskurs. Geschlechterfragen und gesellschaftliche Ordnungen"
Startseite
Das aktuelle LaG-Magazin beschäftigt sich mit Gender aus diskursiver Perspektive: Es bietet Einblicke in historische Debatten um Geschlechterfragen und kontextualisiert aktuelle Diskussionen rund um Gender und Geschlecht. Es ist in Kooperation mit dem Berliner Standort des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin entstanden. Wir bedanken uns herzlich für die Förderung!
Einführung in das LaG-Magazin
„Ob Frauen denken können“? – Diese Tatsache stellten zahlreiche gebildete Männer noch vor gut hundert Jahren in Frage und machten sie zum Gegenstand einer hitzigen Debatte. Das mutet aus heutiger Perspektive nicht nur grotesk an, sondern mag vielleicht auch deshalb verwundern, da aktuell mitunter der Anschein erweckt wird, als seien Debatten über Geschlecht und Gender Ausdruck eines Zeitgeistes, einer woken linksliberalen Diskussionskultur.
Die Auseinandersetzung über die Fragen, wie die Geschlechter zueinander stehen und wie diese gesellschaftlich determiniert und interpretiert werden, wurde lange Zeit von Männern bestimmt. Dabei dienten die historisch unterschiedlich fundierten Geschlechterkonstruktionen auch dazu, gesellschaftliche Ordnungen zu stabilisieren, insbesondere in Zeiten von Krisen bzw. in Reaktion auf sie. Die vorliegende Ausgabe des LaG-Magazins möchte Einblicke in historische Debatten und deren Verlauf gewähren und dadurch die aktuell mitunter aufgeregt geführte Auseinandersetzung über Gender kontextualisieren.
Hannah Lotte Lund beginnt damit Ende des 18. Jahrhunderts und zeichnet nach, wie und mit welch langfristiger Wirkung die Kategorie Natur in die Debatten über die Geschlechter eingeführt wurde.
Tanja Gäbelein zeigt auf, wie Homosexualitäten im Deutschen Kaiserreich verhandelt und diese Zuschreibung als Instrument der Machtausübung eingesetzt wurden.
Die Frage, „ob Frauen denken können“, war eines der Instrumente, um Frauen den Zugang zu Hochschulen zu verwehren. Die Auseinandersetzung und wie es doch gelang, zeichnet Elke Blumberg nach.
Die Rede, die Stefanie Schüler-Springorum anlässlich des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2023 im Thüringer Landtag gehalten hat, ruft in Erinnerung, dass gerade der queeren Opfer des Nationalsozialismus lange Zeit nicht gedacht wurde.
Dass sexuelle Vielfalt auch heute noch als Feindbild dient und für welche Gruppen es Mobilisierungspotenzial bietet, erläutert Gert Pickel.
Monty Ott weist darauf hin, dass es die Aufgabe der globalen Linken gewesen sei, in Reaktion auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 die intersektionale Verschmelzung von Antisemitismus und sexualisierter Gewalt bzw. Antifeminismus zu benennen.
An einem digitalen Roundtable unternehmen Christina Wolff, Sigrid Roßteutscher und Hannah Lotte Lund den Versuch, gemeinsame Argumente und Mechanismen in Geschlechterdebatten zu identifizieren, Differenzen auszuloten und zu ergründen, warum das Thema gesellschaftlich oftmals so aufgeregt diskutiert wird.
Comics und Graphic Novels thematisieren Geschlechterfragen auf vielschichtige und zugleich zugängliche Art und Weise. Sabrina Pfefferle analysiert diesen Zugang zum Thema. Dabei stellt sie „Der Ursprung der Liebe“ von Liv Strömquist ins Zentrum.
Das Schwule Museum als Ort kontroverser (Selbstverständigungs-)Debatten und als Impulsgeber stellt Heiner Schulze vor.
Die Ausstellung „Gemeinsam sind wir unerträglich“ verhandelt unterschiedliche Facetten der unabhängigen Frauenbewegung in der DDR. Einblicke in die Ausstellung und ihren Katalog gibt Sabrina Pfefferle.
Wir freuen uns sehr, dass wir die vorliegende Ausgabe in Kooperation mit dem Berliner Standort des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin umsetzen konnten und bedanken uns herzlich für die Förderung!
Workshop Gedenkstätten an ehemaligen Haftorten als Projektionsflächen
Startseite
Besuchererwartungen als Herausforderung für Bildung, Vermittlung und Forschung
Termin: 15. April 2024
Uhrzeit: 10:00 – 15:30 Uhr
Ort: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Kronenstraße 5, 10117 Berlin
Veranstalter: Lernort Keibelstraße, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
Organisatorinnen: Birgit Marzinka, Katharina Hochmuth, Amélie zu Eulenburg und Irmgard Zündorf
Thema
Gedenkstätten an ehemaligen Haftorten können sowohl faszinieren als auch überwältigen. Jedenfalls wirken sie oftmals emotionalisierend auf Besucherinnen und Besucher, für die sie als Projektionsflächen dienen, die häufig mit sehr individuellen (nicht unbedingt den historischen Tatsachen entsprechenden) Vorstellungen verbunden sind. Denn die Besucherinnen und Besucher kommen mit Vorannahmen; sie haben gefestigte Bilder im Kopf und bringen eine spezifische und individuelle Erwartungshaltung mit. Diese wird beeinflusst durch ihr allgemeines Vorwissen, Medien und manchmal auch familiären Erzählungen (z.B. von Hafterfahrungen). Der historische Ort wird in diesem Fall als authentischer Ort der ehemaligen Haftanstalt interpretiert, ohne die Veränderungen und die Nachnutzung zu berücksichtigen. Das wirft die Frage auf: Wie kann es trotz der starken Wirkung des Ortes und der individuellen Vorannahmen der Besucherinnen und Besucher gelingen, ein differenziertes Bild über die DDR zu vermitteln?
Die Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter von Gedenkstätten stehen vor der Herausforderung, einerseits die Geschichte des jeweiligen Haftortes zu präsentieren und in den historischen Kontext einzubetten. Andererseits bleibt ihnen für ein vertieftes Eintauchen in die komplexen Themen des jeweiligen Ortes kaum ausreichend Zeit. Der Fokus des Angebots liegt häufig auf Kurzeitformaten, wie zum Beispiel klassischen Führungen.
Doch wie können Führungen es leisten, dass sich die die Besucherinnen und Besucher, sich einen Überblick verschaffen, ein eigenes Bild über die Geschichte entwickeln und eigene Urteile bilden können? Wie viel didaktische Reduktion ist erlaubt? Inwieweit ist es möglich, in der pädagogischen Arbeit ein differenziertes Bild zu vermitteln? Wie fließen die Erwartungen der Besucherinnen und Besucher in die Bildungs- und Vermittlungsarbeit mit ein? Wie kann das Thema „Emotionen“ von der Bildungsarbeit aufgenommen werden? Welche Instrumente sind wichtig, um „Emotionen“ und professionelle Distanz auszubalancieren, damit den Besucherinnen und Besuchern Raum für historisches Lernen bleibt? Wie kann vor diesem Hintergrund ein multiperspektivisches Angebot entstehen, das auf aktuellen Forschungsergebnissen beruht und zugleich ansprechend ist? Wie können Wissenschaft und Pädagogik gewinnbringend zusammenarbeiten bzw. wie kann der Austausch gestaltet werden?
Der Workshop möchte Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler und Gedenkstättenpädagoginnen und -pädagogen zusammenbringen und mit ihnen über die skizzierten Fragen, über Kriterien für historisches Lernen am außerschulischen Lernort sowie über aktuelle Forschungsschwerpunkte diskutieren.
Programm
10:00 Uhr Begrüßung
Amélie zu Eulenburg und Birgit Marzinka
Impulsvorträge
(Moderation Katharina Hochmuth)
10:30 Uhr Vortrag
Christiane Birkert (Jüdisches Museum Berlin)
Besucher*innen im Museum – Erwartungen und Wünsche. Methoden und Erkenntnisse der Besucher*innenforschung
11:00 Uhr Vortrag
Kathrin Klausmeier (Universität Leipzig)
Besucher*innen im Fokus. Was heißt Besucher*innenorientierung an Gedenkstätten?
11:30 Uhr Vortrag
Christian Halbrock
Eine Forschungsperspektive auf die Haftorte. Authentischer Ort, Erwartungen, Fakten.
12:00 – 13:00 Uhr: Diskussion (Moderation Irmgard Zündorf)
13:00 – 14:00 Uhr: Mittagspause
14:00 – 15:30 Uhr: Fishbowl: Wie weiter in der Vermittlungsarbeit? (Moderation Birgit Marzinka)
- Elke Stadelmann-Wenz (Gedenkstätte Hohenschönhausen)
- Susanne Schäffner-Krohn (Gedenkstätte Brandenburg-Görden)
- Axel Janowitz (Stasi-Unterlagen-Archiv)
- N.N. (Lehrkraft)
- Jens Gieseke (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung)
Abschluss ca. 15.30 Uhr
LaG-Magazin "Erinnern in Digitalen Spielen"
Startseite
Das neue LaG-Magazin „Erinnern in Digitalen Spielen“ diskutiert die Chancen und Grenzen des Einsatzes Digitaler Spiele in der historisch-politischen Bildung. Gefördert von der Alfred Landecker Foundation.
Einführung in das LaG-Magazin
Interaktives Erinnern mit Hilfe von Digitalen Spielen – wie kann das gelingen? Diese Frage ist grundlegend für das Team, welches aktuell das Digital Remembrance Game „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ entwickelt, das als Ergänzung zum Angebot der Gedenkstätte Bullenhuser Damm in Hamburg konzipiert wird. Diese erinnert an 20 jüdische Kinder und mindestens 28 Erwachsene, die am 20. April 1945 im Keller eines leerstehenden Schulgebäudes von der SS ermordet wurden. Vor ihrer Ermordung wurden die Kinder zu pseudomedizinischen Versuchen im KZ Neuengamme missbraucht.
Das Spiel soll in die Perspektive von fünf Schüler*innen der Schule Bullenhuser Damm in den späten 1970er-Jahren versetzen. In deren Rolle begehen Spielende unterschiedliche Pfade des Erinnerns. Durch die Interaktion mit anderen Menschen und die Integration verschiedener Zeitebenen entsteht aus Sicht der spielenden Protagonist*innen ein persönliches Erinnerungsnarrativ.
Das Spiel wird von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen gemeinsam mit Paintbucket Games für die Hamburger Gedenkstätte Bullenhuser Damm entwickelt und durch die Alfred Landecker Foundation gefördert. Das vorliegende LaG-Magazin wurde gemeinsam mit dem Projektleiter Markus Bassermann konzipiert und nimmt die Frage zum Ausgangspunkt, wie eine ansprechende und respektvolle Gesichtsvermittlung mit Hilfe von Digitalen Spielen gestaltet werden kann.
Steffen Jost, Programmdirektor der Alfred Landecker Foundation, skizziert in seinem Vorwort, wieso und in welchem Rahmen die Stiftung Digitale Spiele fördert.
Akteure der historisch-politischen Bildung greifen gerne auf Spiele zurück, die unter dem Etikett „Serious Game“ eine angemessene Thematisierung ernster historischer Themen versprechen. Doch ist diese Etikettierung mit ihren Implikationen nicht unumstritten, wie die einleitenden Beiträge diskutieren. Felix Zimmermann bietet einen Überblick über die Entstehungsgeschichte von Serious Games und verortet sie in ihrer Funktion im Spannungsfeld zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Nico Nolden wirft die Frage auf, wie eine sinnvolle Kategorisierung von Digitalen Spielen, die Geschichte thematisieren, aussehen könnte und was unterschiedliche Spiele jeweils zur Erinnerungskultur beitragen können.
Da in der vorliegenden Ausgabe ausgehend vom Spiel „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ grundlegende Aspekte diskutiert werden sollen, geben Markus Bassermann, Iris Groschek und Nicole Mattern in ihrem Werkstattbericht zunächst Einblicke in die Konzeption und Entwicklung dieses Digital Remembrance Games.
An seinem konkreten Beispiel diskutierten am 25. September 2023 Markus Bassermann, Mona Brandt, Lucas Haasis, Rüdiger Brandis, Tabea Widmann, Florian Fischer, Mathias Herrmann, Nadine Cremer, Aska Mayer und Christian Günther an einem digitalen Roundtable über die Vermittlungsmöglichkeiten und -grenzen von Digitalen Spielen in der historisch-politischen Bildung. Die wichtigsten Diskussionsstränge werden in ihrem Beitrag dokumentiert. Die Organisation, Koordination und Zusammenstellung der Beiträge haben Lucas Haasis und Peter Färberböck vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele übernommen.
Da immer mehr Akteure der historisch-politischen Bildung ausloten, inwiefern Digitale Spiele das Repertoire der eigenen Gedenkstätte erweitern könnten, ist ein Austausch untereinander wichtig: Iris Groschek trägt die Ergebnisse eines Vernetzungstreffens zusammen, das im Sommer 2023 in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme stattfand. Sie zeigt auf, welche Problemfelder gemeinsam herausgearbeitet wurden – und skizziert erste Ansätze für einen produktiven Umgang mit diesen.
Dass es bereits erfolgreiche Digitale Spiele gibt, in denen Antworten auf die in diesem LaG-Magazin diskutierten Fragen gefunden wurden, illustrieren drei Beispiele:
Anne Sauer und Hannah Sandstede berichten über die Entwicklung des Digitalen Spiels „Spuren auf Papier“ zur NS-„Euthanasie“ als investigative Detektivgeschichte – und über die Herausforderungen für Gedenkstätten und Game-Designer*innen, die diesen Prozess begleitet haben.
Christoph Kreutzmüller präsentiert mit „#lastseen“ ein Suchspiel, das sich auf historische Fotos als Ausgangspunkt der Spielentwicklung fokussiert.
Timo Hellmers erörtert mit einem Beispiel aus der Bildungspraxis des Europäischen Hansemuseums in Lübeck, wie es gelingen kann, museale Angebote mit Hilfe von Digitalen Spielen zu erweitern.
Abschließend geben wir allen, die auf der Suche nach Tipps für den Einsatz von Digitalen Spielen in der schulischen und außerschulischen Bildung sind, einen Überblick über wichtige Zugänge und Materialien: Sabrina Pfefferle rezensiert fünf Handreichungen, die in der Praxis unterstützen können.
Christian Huberts und Malte Grünkorn stellen die Datenbank Games und Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur vor, die Interessierten bei der Auswahl und Erprobung Digitaler Spiele behilflich sein kann.
Wir bedanken uns herzlich bei Markus Bassermann und vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele insbesondere bei Lucas Haasis für Ihre Mitgestaltung, sowie bei der Alfred Landecker Foundation für die Förderung dieser Ausgabe!
Ausstellungskatalog: "Gemeinsam sind wir unerträglich"
Startseite
Beschreibung
Die Ausstellung „Gemeinsam sind wir unerträglich“ (ab 8. Dezember 2023 in der Berliner Gethsemanekirche) und der sie begleitende Katalog erzählen erstmalig die Geschichte der unabhängigen Frauenbewegung der DDR in einer Gesamtschau. Versammelt werden dabei zahlreiche ostdeutsche Stimmen: Zeitzeuginnen blicken zurück, Historiker*innen führen in das Thema ein und vermitteln aktuelle Bezüge. Zahlreiche Dokumente, Fotos und Interviews zeigen, wie sich Anfang der 1980er Jahre die ersten Frauengruppen gründeten. Von Beginn an kritisierten viele dieser Gruppen die Situation von Frauen in der DDR und zogen die staatliche Doktrin von der verwirklichten Gleichberechtigung der Frauen in Zweifel. Am Ende der DDR entfaltete sich eine landesweit agierende Bewegung. Im demokratischen Aufbruch der Jahre 1989 und 1990 saßen ihre Akteur*innen an den Runden Tischen und forderten eine geschlechtergerechtere Gesellschaft ein.
Herausgeberinnen
Ulrike Rothe ist Historikerin und Soziologin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V..
Rebecca Hernandez Garcia studierte Geschichte, Philosophie und Archivwissenschaften. Sie ist Archivleiterin der Robert Havemann Gesellschaft – Archiv der DDR-Opposition.
Weitere Informationen
Der Ausstellungskatalog ist über den Buchhandel erhältlich.
Verlag: Mitteldeutscher Verlag
ISBN: 978-3-96311-872-2
Seitenzahl 196
Erscheinungsdatum: 01.12.2023
Rückblick auf die Vernissage in der Gethsemanekirche am 8. Dezember
Die Vernissage der Ausstellung fand am 8. Dezember 2023 in der Gethsemanekirche Berlin-Prenzlauer Berg statt. Nach einem Grußwort von Kvon Evelyn Zupke (SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag) und einer Eröffnungsrede von Ulrike Rothe (Kuratorin), sprachen Katharina Hochmuth (Leiterin des Arbeitsbereichs Schulische Bildungsarbeit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), Dr. Martina Weyrauch (Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung), Dr. Jessica Bock (Historikerin) und Judith Geffert (Kuratorin) über die Ausstellung. Moderiert wurde das Podiumsgespräch von Rebecca Hernandez Garcia (Kuratorin). Die Veranstaltung wurde von Beate Wein musikalisch begleitet.
Die Ausstellung wurde mit freundlicher Unterstützung des Digitalen Deutschen Frauenarchivs eröffnet. Die Ausstellung wird gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und des Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.


Auszeichnung "Aktiv für Demokratie und Toleranz" der bpb
Startseite
Vielen Dank für die Auszeichnung!
Wir freuen uns sehr, eines der Projekte zu sein, die im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2023 der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet wurden. Schaut Euch auf dem Instagram-Kanal von @bpb_engagiert auch die anderen tollen Projekte an!
Weitere Informationen über den Wettbewerb auf der Webseite der bpb